
|
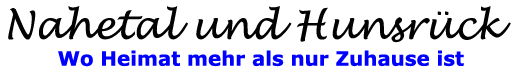
|

|
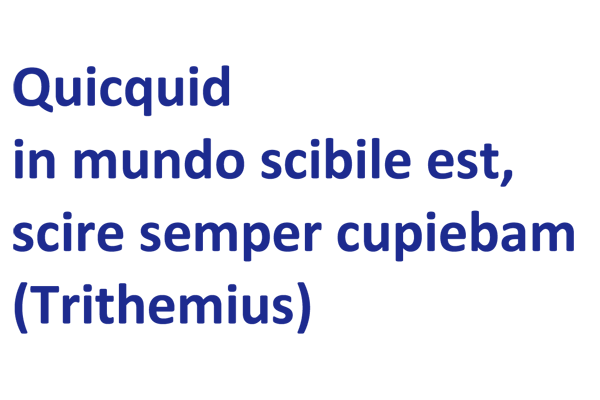
|
Die Römer im Nahetal und HunsrückNach der Eroberung Galliens durch Cäsar (58-51 v. Chr.), die mit vernichtenden Niederlagen der Kelten einherging, waren weite Teile Europas über fast 5 Jahrhunderte als römisches Imperium unter der "Pax Romana" (römischer Frieden) vereinigt mit einheitlichem Währungs- und Verwaltungssystem. Der zivilisatorische und kulturelle Einfluss Roms mit seiner fortgeschrittenen Technik, seinem hohen Organisationsgrad und seiner hochentwickelten Schrift hat dabei das westliche Abendland tiefgreifend und nachhaltig verändert. Wie rasch dieser Romanisierungsprozess schon bald nach dem Sieg Cäsars ablief, lässt sich zum Beispiel an den Gräberfeldern der keltischen Treverer im Hunsrück gut verfolgen. Die neu gegründeten römischen Städte und Dörfer taten ein Übriges, auch wenn die erdrückenden Steuerlasten der Römer mehrfach zu Aufständen führten. Die Ansiedlung von römischen Veteranen geschah systematisch und sollte die Versorgung von Militärpersonal und Zivilbevölkerung sicherstellen. Die vorherrschende ländliche Besiedlungsform war das Einzelgehöft (lateinisch: villa rustica), dessen Größe variierte und das meist mit einer Mauer umgeben war. Ein solches Gehöft umfasste in der Regel ein Hauptgebäude als Wohnhaus, eine Badeanlage und diverse Nebengebäude mit Wirtschaftsfunktionen. Neben Landwirtschaft und Viehhaltung wurden auch handwerkliche Tätigkeiten (Metall- und Holzverarbeitung) ausgeübt. Mit der prosperierenden Wirtschaft entstanden überall im Lande Töpferei- und Keramikbetriebe an verkehrsgünstigen Punkten mit reichen Tonlagerstätten ("Terra-Sigillata-Manufakturen"), so beispielsweise südlich des Nahetals bei Germersheim in der Pfalz. Mittelpunkt der Städte war das Forum in dessen Nebenräumen die Händler ihre Verkaufsläden hatten (lateinisch: tabernae). Bildung und SchuleObwohl die Kelten der Latène-Zeit die Schrift kannten (griechisches Alphabet), haben erst die Römer die Verwendung der Schrift (lateinisches Alphabet) im großen Stile zu einem wesentlichen Bestandteil des Alltagslebens gemacht. In der Folge war nicht mehr ausschließlich die Oberschicht des Lesens und Schreibens kundig, sondern auch die Mehrzahl der Händler, Handwerker, Soldaten, Gutsbesitzer und sogar der Sklaven. Erst hierdurch konnte der tägliche Verkehr mit lokalen und staatlichen Einrichtungen und Verwaltungen reibungslos bewältigt werden. Regelmäßiger Schulbesuch gehörte zum Alltag der Kinder, während privater Unterricht der Oberschicht vorbehalten war. Jeder halbwegs wohlhabende Bürger wird vermutlich auch eine kleine Privatbibliothek mit den damaligen "Klassikern" besessen haben, wie archäologische Funde nahe legen. Darüber hinaus dürften in großen Städten wie Trier auch öffentliche Bibliotheken existiert haben. An all dem lässt sich ablesen, dass für den Zusammenhalt des römischen Imperiums eine gleichartige und gleichmäßig hohe Bildung von entscheidender Bedeutung war. Ein Relief, das in Neumagen (lateinisch: Noviomagus) an der Mosel gefunden wurde, zeigt eine Unterichtsszene und unterstreicht damit die große Bedeutung, die der Schulbildung im römischen Imperium beigemessen wurde. Neumagen ist direkt an der alten Römerstraße "Via Ausonia" gelegen, die über den Hunsrück von Mainz über Bingen nach Trier führte. Römische BadeanlagenDas Badewesen, von den Griechen im 3. Jahrhundert v. Chr. übernommen, entwickelte sich in der Folgezeit zu einem Inbegriff römischer Lebensart und Kultur: keine Garnison und keine Siedlung ohne öffentliche Thermengebäude, kein römischer Gutshof, der nicht mindestens 2 Baderäume gehabt hätte. Neben hygienischen Bedürfnissen lagen dem Badewesen auch medizinische Aspekte zugrunde. Davon zeugen die vielen Kurbäder, die meist in der Umgebung von Legionsstandorten entstanden, aber auch für die medizinische Versorgung der zivilen Bevölkerung offen standen. Der Badevorgang bestand aus mehreren Phasen der Erwärmung, Erhitzung und Abkühlung des Körpers. Alle Badeeinrichtungen wiesen deshalb das gleiche Raumprogramm auf: (1) im Auskleideraum (lateinisch: apodyterium) entledigte man sich der Kleidung, (2) im Kaltbaderaum (lateinisch: frigidarium) reinigte man sich von Staub und Schmutz, (3) im Aufwärmeraum (lateinisch: tepidarium) wärmte man sich auf, wurde eingeölt und massiert; häufig gab es dort auch Sitzbacken mit erwärmtem Wasser, (4) im Schwitzbad (lateinisch: caldarium) herrschte eine Temperatur von über 50 Grad; danach ging es wieder in den Kaltbaderaum, wo man im Kaltwasserbecken den erhitzten Körper abschreckte. Wenn vorhanden, wurde anschließend noch das Schwimmbad (lateinisch: piscina) aufgesucht. Der Badevorgang begann am Nachmittag, dauerte bis zu 2 Stunden und wurde individuell variiert. Die Badeanlagen waren deshalb nicht nur ein Ort der Muße, Erholung, Gesundheit und Körperertüchtigung, sondern auch Zentren des politischen und gesellschaftlichen Lebens, wo sich die reiche Oberschicht für abendliche Gastmähler verabredeten und Gesellschaften arrangierten. Die Abbildung zeigt einen Ausschnitt eines Mosaikfußbodens einer römischen Luxusvilla aus der Mitte des 2. Jahrhunderts n. Chr., die bei Bad Kreuznach (lateinisch: Cruciniacum) ausgegraben wurde. Das Mosaik zeigt den Meeresgott Oceanus, Meerestiere, Schiffe und Hafenszenen. WeinanbauIm Nahetal und in der Hunsrückregion finden sich Zeugnisse schon aus keltischer Zeit für den Import von Wein aus dem Mittelmeerraum. Dies im Zusammenhang mit dem Rohstoffhandel von Kupfer, Zinn und Eisen durch die Etrusker von Vulci, die in der Hallstattzeit (800-475 v. Chr.; so genannt nach dem wichtigsten archäologischen Fundort Hallstatt am Hallstätter See, Österreich) den "europäischen" Rohstoffhandel stark intensiviert und ausgebaut hatten. Mit der römischen Eroberung und der Übernahme mediterraner Ernährungsweisen kam dem Weinhandel eine immer größer werdende Bedeutung zu. Der Weinanbau spielte aufgrund gesetzlicher Beschränkungen jedoch als eigenständiger Wirtschaftszweig bis zum 3. Jahrhundert n. Chr. keine besondere Rolle. Die eigentliche Entwicklung des Weinanbaus begann im Moseltal mit einem Dekret des römischen Kaisers Probus (278-280 n. Chr.), in welchem er den Anbau von Wein generell erlaubte. GermanenkriegeNach der Okkupation ganz Galliens durch Cäsar (51 v. Chr.) und der systematischen Erschließung der Gebiete westlich des Rheins und deren Konsolidierung, folgte unter Drusus (12-9 v. Chr.) die Eroberung rechtsrheinischer Gebiete bis hin zur Elbe. Durch die darauf einsetzenden ständigen Scharmützel mit den dort ansässigen Germanen und die für die römischen Legionen vernichtende Niederlage in der Varus-Schlacht, wurde der Rhein jedoch defacto wieder zur römischen Staatsgrenze (7-9 n. Chr.). Erst unter Kaiser Vespasian (69-79 n. Chr.) begann die Landnahme östlich des Rheins erneut in größerem Umfange und es entstanden die Provinzen Germania Superior und Germania Inferior in den Jahren 83-85 n. Chr. mit den Hauptstädten Mainz und Köln. Wegen der beständigen Gefährdung durch Einfälle der umliegenden Germanenstämme in die eroberten Gebiete errichteten die Römer während der Regierungszeit Traians (98-117 n. Chr.) eine Grenzbefestigungsanlage mit Wachtürmen und Kastellen in regelmäßigen Abständen —genannt der Limes. Der endgültige Ausbau auf einer Linie Eining nördlich von Neustadt an der Donau, Gunzenhausen, Dinkelsbühl, Böbingen östlich von Schwäbisch Gemünd, Jagsthausen, Miltenberg am Main, Groß-Krotzenburg bei Hanau, Arnsburg südlich von Giessen, Butzbach, Großer Feldberg im Taunus, Arzbach bei Bad Ems, Niederbiber bei Neuwied, und Bad Hönningen bei Linz am Rhein, wurde um das Jahr 150 n. Chr. abgeschlossen. Die verlustreichen Markomannenkriege gegen Ende des 2. Jahrhunderts n. Chr. bildeten dann einen ersten Höhepunkt in der kriegerischen Auseinandersetzung zwischen Römern und Germanen. Auf der Suche nach Land und Beute drangen germanische Stämme mit Beginn des 3. Jahrhunderts vermehrt in römisches Reichsgebiet vor. Durch Truppenabzüge der Römer für Abwehrkriege gegen die Perser verschlechterte sich die Sicherheitslage in den rechtsrheinischen Gebieten um das Jahr 250 n. Chr. dramatisch. Die unter Diocletian durchgeführte Neuorganisation der Provinzen um 297 n. Chr. berücksichtigt das ehemalige Limesgebiet nicht mehr. Alamannen und Franken stießen beständig auf das Reichsgebiet vor. Erst in der Mitte des 4. Jahrhunderts n. Chr. unter Valentinian I. (364-375 n. Chr.) gewann das Verteidigungssystem der Provinz wieder feste Formen mit dem Ausbau der Rheinlinie. Das Ende der römischen Herrschaft im 5. Jahrhundert n. Chr. wurde durch eine stete Zuwanderung von Germanen eingeleitet. Dabei wurde die romanische Bevölkerung aber nicht verjagt oder ausgerottet, sondern ging schließlich durch allmähliche Assimilation in der mengenmäßig überlegenen germanischen Bevölkerung unter. Die städtischen Siedlungen wurden in der Regel weiter benutzt, das Wirtschaftssystem der villa rustica endete jedoch mit einer scharfen Zäsur. Ausgewählte Eckdaten
|
|

Relief einer Unterrichtsszene aus Neumagen (lateinisch: Noviomagus) an der Mosel. Dieses Relief unterstreicht die große Bedeutung, die der Schulbildung im römischen Imperium beigemessen wurde.
|
|
|
| [ Mail to Webmaster ] info@maasberg.ch |